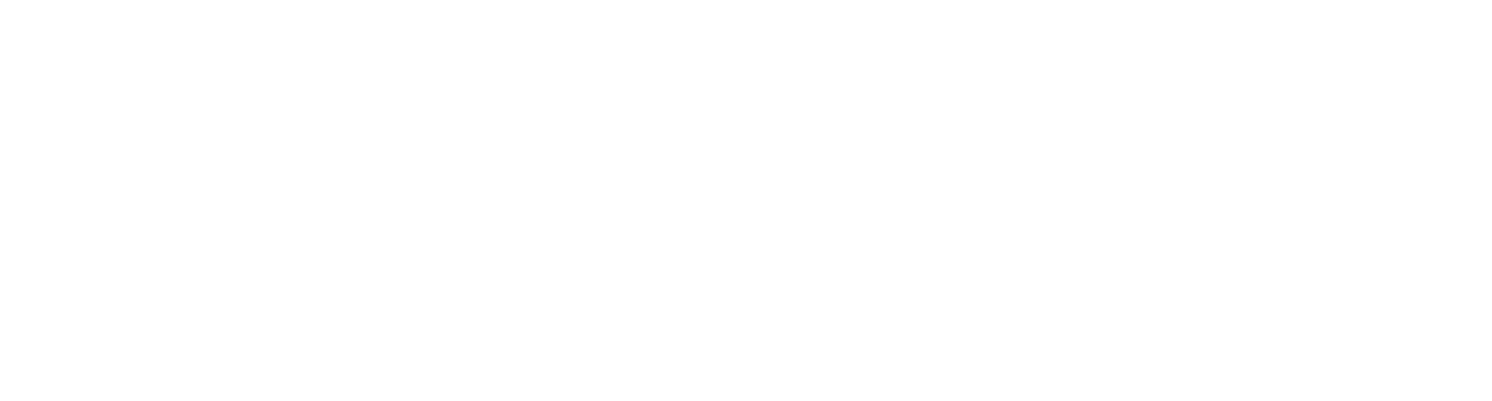Die Vorschriften zum deutschen und europäischen Produktsicherheitsrecht und damit auch zur CE-Kennzeichnung entwickeln sich laufend weiter. Auch im Jahr 2026 müssen die davon betroffenen Unternehmen wieder Änderungen und Neuerungen beachten.
Produktsicherheit und CE-Kennzeichnung: Das erwartet uns 2026
Themen: CE-Kennzeichnung / Konformitätserklärung, Maschinenrichtlinie / Maschinenverordnung, Richtlinien und Normen
Leitlinien zur Anwendung der Produktsicherheitsverordnung
Die Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 ist seit dem 13.12.2024 anzuwenden. Sie regelt die Sicherheit von Verbraucherprodukten, die auf dem europäischen Binnenmarkt in Verkehr gebracht werden.
Wie bei allen Rechtsvorschriften ist auch der Wortlaut der Produktsicherheitsverordnung nicht immer so klar und verständlich, wie es sich die betroffenen Hersteller wünschen würden. Die EU-Kommission weiß das und bemüht sich deshalb, mit Leitfäden oder Guidelines die europäischen Vorschriften zu erläutern und durch Beispiele zu veranschaulichen. So gibt es zum Beispiel für die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG einen Leitfaden, der inzwischen über 500 Seiten stark ist!
Für die Produktsicherheitsverordnung hat ein solcher Leitfaden bisher gefehlt. Nun aber hat die EU-Kommission das nachgeholt und am 21.11.2025 die “Leitlinien zur Anwendung des EU-Rechtsrahmens für die allgemeine Produktsicherheit durch Unternehmen” im Amtsblatt veröffentlicht (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202506233).
Themen: CE-Kennzeichnung / Konformitätserklärung, Maschinenrichtlinie / Maschinenverordnung, Richtlinien und Normen
Wesentliche Veränderung nach neuer Maschinenverordnung (EU) 2023/1230
Die Ausgangslage
Maschinen sind langlebige Investitionsgüter, die oft über mehrere Jahrzehnte betrieben werden. Das führt dazu, dass bestehende Maschinen regelmäßig erweitert, umgebaut oder modifiziert werden. Dabei stellt sich jedes Mal die Frage:
Themen: CE-Kennzeichnung / Konformitätserklärung, Maschinenrichtlinie / Maschinenverordnung, Richtlinien und Normen
Dabei stellt sich die Frage, welchen rechtlichen Anforderungen die Produkte aus dem 3D-Drucker eigentlich unterliegen. Gibt es hier Besonderheiten oder greifen die allgemeinen Vorschriften? Diese Fragen sollen im Hinblick auf die Produktsicherheit und CE-Kennzeichnung im Folgenden beantwortet werden.
CE-Kennzeichnung für 3D-Produkte
Produktbegriff
Der Produktbegriff im Rahmen der CE-Kennzeichnung ist sehr weit gefasst. Der Begriff „Produkt“ wird in den verschiedenen CE-Vorschriften der Union unterschiedlich verwendet. Die unter die Rechtsvorschriften fallenden Gegenstände werden beispielsweise als Produkte, Ausrüstungen, Apparate, Geräte, Einrichtungen, Instrumente, Stoffe, Vorrichtungen, Ausrüstungsteile oder Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion, Einheiten, Elemente, Zubehörteile, Systeme oder unvollständige Maschinen bezeichnet. (sh. Blue Guide 2022, 2.1. Erfasste Erzeugnisse).
Was aber ganz egal ist, ist die Art und Weise der Fertigung von Produkten. D.h. ob Produkte konventionell hergestellt werden oder mittels additiver Fertigung, spielt keine Rolle für den Produktbegriff im Rahmen der CE-Vorschriften.
Hersteller
Die CE-Vorschriften verpflichten den Hersteller eines Produkts, die wesentlichen Anforderungen einzuhalten.
Im 3D-Druck sind oftmals verschiedene Akteure mit dabei: Z.B. der Betreiber des 3D-Druckers, der Ersteller der 3D-Datensätze oder ein Auftraggeber, der die beiden anderen beauftragt hat.
Im Sinne der CE-Vorschriften gibt es aber immer nur einen Hersteller:
Als Hersteller wird diejenige natürliche oder juristische Person bezeichnet, die ein Produkt herstellt bzw. entwickeln oder herstellen lässt und dieses Produkt unter ihrem eigenen Namen oder ihrer eigenen Marke vermarktet.
Damit ist ist also derjenige in der Pflicht, der das Produkt druckt. Außer er ist nur die verlängerte Werkbank für jemanden, der das gedruckte Produkt unter seinem Namen oder seiner Marke vertreibt.
Anwendungsbereich
Bei der Frage, unter welche CE-Vorschriften ein 3D-Produkt fällt, ist wie bei konventionellen Produkten zu prüfen, ob es in den Anwendungsbereich einer CE-Vorschrift fällt oder ob es auf Grund seiner Eigenschaften von diesem ausgeschlossen ist.
Deswegen sind - je nach Art des 3D-Produkts - zunächst ganz verschiedene CE-Vorschriften denkbar, z.B.
- Spielzeuge (Richtlinie 2009/48/EG)
- Medizinprodukte (Verordnung (EU) 2017/745)
- Maschinen (Maschinenrichtlinie 2006/42/EG bzw. Maschinenverordnung (EU) 2023/1230)
- Druckgeräte (Richtlinie 2014/68/EU) oder
- Bauprodukte (Bauproduktenverordnung (ab dem 8. Januar 2026 gilt VO (EU) 2024/3110)
Spielzeug
Im Internet finden sich vielfältige Angebote von Spielzeug aus dem 3D-Drucker. Für Produkte, die dazu bestimmt oder gestaltet sind, von Kindern unter 14 Jahren für den Gebrauch beim Spielen verwendet zu werden, gilt derzeit die Richtlinie 2009/48/EG.
Obacht: Das schließt nicht nur Produkte ein, die ausschließlich dazu bestimmt sind, sondern auch solche die auch als Spielzeug verwendet werden können, obwohl das nicht die ausschließliche Funktion ist, z.B. Figuren an Schlüsselanhängern.
In diesem “Graubereich” gilt es gut aufzupassen. Wer z.B. Sammlerfiguren oder Modelle druckt, muss prüfen, ob das vielleicht auch als Spielzeug eingeordnet wird.
Mehr dazu finden Sie hier: Guidance
Die aktuelle Spielzeugrichtlinie soll übrigens demnächst durch eine neue Spielzeugverordnung ersetzt werden. Dann soll auch ein digitaler Produktpass für Spielzeug eingeführt werden.
Medizinprodukte
Unter die Maschinenrichtlinie fallen nicht nur “klassische” Maschinen mit kraftbetätigten beweglichen Teilen, sondern auch Produkte wie Ketten, Seile und Gurte oder Lastaufnahmemittel wie z.B. C-Haken. Wer solche Produkte druckt, muss prüfen, ob sie in den Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie oder zukünftig der Maschinenverordnung fallen.
Einzelheiten und Beispiele finden sich im Leitfaden zur Maschinenrichtlinie unter § 412.
DocsRoom - European Commission
Druckgeräte
Die Herstellung von Druckgeräten im Sinne der Richtlinie 2014/68/EU ist grundsätzlich sehr interessant für den 3D-Druck. Sie fordert den Hersteller im Rahmen der additiven Fertigung in der Regel aber gleich doppelt: Zum einen wird aus dem Druckmaterial ein “Werkstoff” hergestellt, der bestimmten Kriterien entsprechen muss, und zum anderen sind die Anforderungen aus der Richtlinie selbst einzuhalten.
Bauprodukte
Die neue Bauproduktenverordnung (gilt ab dem 8. Januar 2026 VO (EU) 2024/3110) ist die erste CE-Vorschrift, die 3D-Produkte explizit erwähnt (Artikel 3 und 22). Sie tut dies, um klarzustellen, dass durch den 3D-Druck die Anforderungen an Bauprodukte nicht umgangen werden dürfen. Außerdem wird definiert, wer als Hersteller eines 3D-gedruckten Bauprodukts gilt und für was er verantwortlich ist:
“Eine natürliche oder juristische Person, die ein Produkt mit 3D-Druck herstellt, muss die Verpflichtungen erfüllen, die Herstellern beim Inverkehrbringen obliegen. Die Verpflichtungen umfassen unter anderem die Verwendung geeigneter 3D-Datensätze, die Verwendung von Materialien, die den geltenden Verfahren gemäß dieser Verordnung entsprechen, sowie die Überprüfung der Kompatibilität von 3D-Datensätzen, Druckmaterial und der verwendeten Drucktechnik. (Art. 22 Abs. 1)”
CE-Prozess
Für alle Produkte, die in den Anwendungsbereich einer CE-Vorschrift fallen, sind die wesentlichen Anforderungen und die möglichen Konformitätsbewertungsverfahren in diesen Vorschriften geregelt.
Grundsätzlich läuft dieser Prozess wie folgt ab:
- Anwendungsbereich prüfen
- Ausnahmen prüfen
- Konformitätsbewertungsverfahren klären (Ist eine benannte Stelle nötig?)
- Wesentliche Anforderungen einhalten
- Anforderungen aus Normen prüfen
- Risikobeurteilung durchführen
- Technische Unterlagen erstellen
- Betriebsanleitung erstellen
- Konformitätserklärung erstellen
- CE-Kennzeichnung anbringen
Zum Thema Konformitätsbewertungsverfahren:
Je nach Art des Produkts führt der Hersteller den Prozess entweder alleine durch (Interne Fertigungskontrolle - Modul A) oder er muss eine benannte Stelle einschalten, z.B. zur Baumusterprüfung oder zur Prüfung eines umfassenden Qualitätssicherungssystems.
Das ist abhängig von verschiedenen Faktoren, z.B.
- der Anwendung von harmonisierten Normen (z.B. EN 71 für Spielzeug)
- der Kategorie eines Druckgeräts oder
- der (Risiko-)Klasse bei Medizinprodukten.Anwendung der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988
Anwendung der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988
Aber auch dann, wenn ein Produkt nicht in den Anwendungsbereich einer CE-Vorschrift fällt, kann es europäischem Produktsicherheitsrecht unterliegen. Seit dem 13.12.2024 gilt die Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 für alle Verbraucherprodukte, die am Markt bereitgestellt werden.
Wenn also das 3D-Produkt für Verbraucher bestimmt ist, dann muss der Hersteller diese Vorschrift beachten. Und das gilt auch dann, wenn die Produkte unter vernünftigerweise vorhersehbaren Bedingungen wahrscheinlich von Verbrauchern benutzt werden, selbst wenn sie nicht für diese bestimmt sind! Und das ist gerade beim Online-Vertrieb von 3D-Produkten nur schwer auszuschließen.
Weitere Informationen zu den Anforderungen der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 finden Sie hier: Neue EU-Produktsicherheitsverordnung: Was Hersteller und Importeure beachten müssen
Wichtig: Gerade die Aufbewahrungspflichten, aber auch das Management von Beschwerden und Reklamationen sind Aufgaben, die über einen längeren Zeitraum fortdauern, auch wenn keine Produkte mehr aktiv vertrieben werden. Deswegen sollten sich Hersteller von 3D-Produkten bewusst machen, welche Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen sich aus einem Markteintritt ergeben. Der 3D-Druck bewirkt hier keine Vergünstigung oder Vereinfachung bei den Produktsicherheitsanforderungen.
Bisher nicht geregelte Produkte (z.B. auch industrielle Bauteile für Maschinen)
Fällt ein 3D-Produkt nicht unter die CE-Vorschriften und auch nicht unter die Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988, dann greifen erstmal keine europäischen Produktsicherheitsvorschriften. Das gilt auch für additiv gefertigte industrielle Bauteile, die z.B. in Maschinen oder Fahrzeugen eingesetzt werden sollen.
Mithin also für einen sehr lukrativen Markt, bei dem der 3D-Druck viele seiner Vorteile einbringen kann: Herstellung von Klein- oder Kleinstserien, keine Lagerkosten, trotzdem schnelle Verfügbarkeit usw.
Da es keine “gesetzlichen” Produktsicherheitsanforderungen für diese Produkte gibt, haben sich inzwischen Normen, Testverfahren und Zertifizierungen etabliert, die sowohl für den 3D-Drucker als auch für den Kunden Vorteile bieten:
Der Kunde kann über die Zertifizierung die tatsächlichen Fähigkeiten der Bauteillieferanten überprüfen.
Der Bauteillieferanten kann Industrieaufträge erhalten. Die Nachweise durch Tests und Zertifizierung sorgen so für einen erfolgreichen Übergang vom reinen Prototyping zur (industriellen) Additiven Fertigung (AM) im Serienfertigungskontext.
Angebote des TÜV NORD für Prüfungen und Qualitätssicherung
- Zertifizierte Managementsysteme
- Mechanisch-technologische Tests (https://www.iam-approved.com/) wie beispielsweise
- Kerbschlagbiegeversuch nach DIN EN ISO 148-1
- Zugversuch gemäß DIN EN ISO 6892-1
- Vormaterialprüfungen
- Bauteilbezogene Prüfungen
- Zertifizierung der additiven Fertigungsprozesse - Herstellerzertifizierung (DIN EN ISO/ASTM 52920)
Additive Fertigung (Additive Manufacturing)
CE-CON - Ihr Ansprechpartner rund um Produktsicherheit und CE-Kennzeichnung
Sie suchen Unterstützung bei der Recherche von CE-Vorschriften und Normen oder der Erstellung der notwendigen technischen Dokumentation wie Risikoanalysen oder Betriebsanleitung.
Oder Sie haben konkrete Fragen zur Einordnung Ihrer 3D-Produkte unter CE-Vorschrift oder zu den Herstellerpflichten gemäß Produktsicherheitsverordnung?
Kommen Sie gerne einfach auf uns zu. Wir unterstützen Sie gerne!
E-Mail: vertrieb@ce-con.de
Themen: CE-Kennzeichnung / Konformitätserklärung, Maschinenrichtlinie / Maschinenverordnung, Richtlinien und Normen
Die Regelungen zur das Inverkehrbringen und Inbetriebnehmen von Maschinen richten sich ab der 20.1.2027 nach der neuen Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 (MVO). Als EU-Verordnung ist diese Vorschrift auch in Deutschland unmittelbar geltendes Recht.
Im Gegensatz zur alten Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, die über die 9. Produktsicherheitsverordnung erst in nationales Recht überführt werden musste.
Allerdings gibt es in der MVO ein paar Punkte, die nicht direkt in der Verordnung geregelt werden konnten:
-
Sprachvorgaben für Konformitätserklärungen und Betriebsanleitungen bzw. Einbauerklärungen und Montageanleitungen
-
Bußgeld- und Strafvorschriften
-
Zuständigkeiten nationaler Stellen z.B. für die Notifizierung von Konformitätsbewertungsstellen
Dafür ist ein “Maschinenverordnung-Durchführungsgesetz (MaschinenDG)” nötig. Dieses Gesetz war auch im Sommer 2024 schon auf einem guten Weg, dann aber hat das Ende der Ampelkoalition und die damit verbundene “sachliche Diskontinuität” dazu geführt, dass das laufende Gesetzgebungsverfahren nicht zu einem Ende kam und das MaschinenDG noch einmal als neuer Gesetzentwurf in der laufenden 21. Legislaturperiode eingebracht werden musste.
Das ist inzwischen passiert und der Entwurf für das MaschinenDG vom 8.9.2025 (Drucksache 21/1507) liegt nun vor: https://dserver.bundestag.de/btd/21/015/2101507.pdf
Was wird sich durch das MaschinenDG ändern?
Wenig. Laut Bundesregierung verursacht das Gesetz keinen Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft, der über den von der MVO (EU) 2023/1230 ausgelösten Erfüllungsaufwand hinausgeht.
Regelungen zur Sprachfassung
Aufpassen muss man bei der Montageanleitung für unvollständige Maschinen. Bisher konnten der Hersteller der unvollständigen Maschine und sein Kunde (also der Integrator, der die unvollständige Maschine in seine Anlage einbaut) sich vertraglich auf eine beliebige Amtssprache der EU für die Sprache der Montageanleitung einigen. Man konnte z.B. mit einem Zulieferer aus Polen vereinbaren, dass er die Montageanleitung für eine unvollständige Maschine, die nach Deutschland geliefert wird, auf Englisch liefert. Das geht nun nicht mehr. Der polnische Hersteller muss jetzt eine deutschsprachige Montageanleitung mitliefern. Abweichende vertragliche Vereinbarungen mit seinem deutschen Kunden sind nicht mehr möglich.
Bußgeldvorschriften
Außerdem sind die Tatbestände für Bußgelder erweitert und an die Anforderungen der MVO angepasst worden. Besonders kritisch sind folgende Tatbestände, bei denen ein Bußgeld bis 100.000 € fällig werden kann:
-
Wenn Hersteller, die der Auffassung sind oder Grund zu der Annahme haben, dass eine von ihnen in Verkehr gebrachte oder in Betrieb genommene Maschine nicht der MVO entspricht, nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig die erforderlichen Korrekturmaßnahmen ergreifen.
-
Wenn Einführer, die der Auffassung sind oder hat er Grund zu der Annahme haben, dass eine Maschine nicht der MVO entspricht, diese in Verkehr bringen, bevor die Konformität der Maschine hergestellt ist.
-
Wenn Händler, die der Auffassung sind oder hat er Grund zu der Annahme haben, dass eine Maschine nicht der MVO entspricht, diese am Markt bereitstellen, bevor die Konformität der Maschine hergestellt ist.
Damit werden auch also Importeure und Händler in die Pflicht genommen, auf die Konformität der Produkte zu achten.
CE-CON unterstützt Sie bei der Umsetzung der neuen MVO
Sie haben Fragen zu den Anforderungen der neuen MVO oder benötigen eine Schulung zu den neuen Regelungen?
Kein Problem: Die Fachleute der CE-CON GmbH unterstützen Sie gerne und helfen Ihnen dabei, rechtzeitig zum Anwendungsbeginn am 20.1.2027 alles vorzubreiten.
Schicken Sie uns einfach eine kurze Nachricht und vereinbaren Sie einen Termin mit uns.
Themen: CE-Kennzeichnung / Konformitätserklärung, Maschinenrichtlinie / Maschinenverordnung, Technische Dokumentation, Richtlinien und Normen
Einleitung
Im Rahmen der CE-Kennzeichnung ist die Betriebsanleitung ein wichtiges Element für die Konformität und Sicherheit von Produkten.
Deswegen trägt z.B. der Blue Guide 2022 dem Hersteller auf, ein Produkt entsprechend den anzuwendenden Harmonisierungsrechtsvorschriften mit Gebrauchsanweisungen und Sicherheitsinformationen in einer für die Verbraucher und Endnutzer leicht verständlichen und vom betreffenden Mitgliedstaat bestimmten Sprache zu versehen. (sh. Blue Guide 2022, Kapitel 3.1).
Auch für Maschinen gilt, dass eine Betriebsanleitung „beigefügt“ werden muss. Dieses „Beifügen“ wurde bisher so verstanden, dass eine Anleitung in Papierform zu liefern ist.
So noch im Leitfaden zur MRL in der Version 2.2:
„Der allgemeine Konsens lautet, dass sämtliche Anleitungen, die für Sicherheit und Gesundheitsschutz relevant sind, in Papierform mitgeliefert werden müssen, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass der Benutzer Zugang zu einem Lesegerät für das Lesen einer in elektronischer Form oder auf einer Website zur Verfügung gestellten Betriebsanleitung hat. Häufig ist es jedoch hilfreich, die Betriebsanleitung in elektronischer Form und im Internet sowie in Papierform zur Verfügung zu stellen, da der Benutzer damit die elektronische Fassung bei Bedarf herunterladen und sich wieder ein Exemplar der Betriebsanleitung beschaffen kann, falls das Papierexemplar verlorengegangen ist. Diese Vorgehensweise erleichtert auch gegebenenfalls erforderliche Aktualisierungen der Betriebsanleitung.“
Dieser dort festgestellte allgemeine Konsens wurde von den Anwendern der CE-Vorschriften aber immer mehr angezweifelt. Denn die Digitalisierung nahm zu und das Festhalten an der Papieranleitung wurde als anachronistisch angesehen.
Regelung der neuen Maschinenverordnung (EU) 2023/1230
Mit der Veröffentlichung der neuen Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 wurde diesen Forderungen Rechnung getragen und eine digitale Betriebsanleitung endlich möglich. Dort steht nun in Art. 10 Abs. 7:6
„Die Betriebsanleitung kann in digitaler Form bereitgestellt werden.“
Ist damit jetzt alles geklärt? Wird alles digitaler und einfacher? Sind Anleitungen in Papierform nun endgültig Geschichte? Und wie sieht es eigentlich bei anderen CE-Vorschriften aus?
Diese Fragen werden im Folgenden geklärt.
Wird die digitale Anleitung jetzt zur Pflicht?
So wie es vor der Veröffentlichung der Maschinenverordnung nicht wirklich einen allgemeinen Konsens gab, dass nur die Papierform zählt, so wird es nun auch keinen allgemeinen Konsens geben, dass nur digital das Wahre ist.
Wer z.B. Sondermaschinen mit Losgröße 1 baut oder Maschinen für den eigenen Betrieb konstruiert, tut sich oftmals leichter, die Anleitung einfach einmal in gedruckter Form zu erstellen und beizufügen. Denn so muss er sich nicht weiter um die konkreten Anforderungen an eine digitale BA kümmern. Für alle diese Hersteller eine gute Nachricht:
Die Anleitung „kann“, sie „muss“ aber nicht in digitaler Form bereitgestellt werden.
Am anderen Ende der Skala stehen die Hersteller, die schon jetzt über fortschrittliche Konzepte für digitale Anleitungen verfügen und z.B. Kundendatenplattform mit optimierten Inhalten und unterschiedliche Medienkanälen wie Videos oder sogar Augmented Reality einsetzen. Sind sie nun fein raus und ist jede digitale Anleitung automatisch konform mit der neuen MVO?
Leider nicht. Denn es gibt in Artikel 10 Abs. 7 MVO wie schon angesprochen einige Anforderungen an digitale Betriebsanleitungen, die es durchaus in sich haben.
Anforderungen an die digitale BA nach MVO
Die MVO stellt folgende Anforderungen an die digitale BA:
-
Der Hersteller muss auf der Maschine angeben, wie auf die digitalen Betriebsanleitungen zugegriffen werden kann
-
Das digitale Format muss es dem Nutzer ermöglichen, die Betriebsanleitung auszudrucken, herunterzuladen und auf einem elektronischen Gerät zu speichern
-
Die Anleitung muss mindestens 10 Jahre online zugänglich sein
-
Bei Maschinen, die für nichtprofessionelle Nutzer bestimmt sind, müssen „Sicherheitsinformationen“ in Papierform bereitgestellt werden
-
Wenn es der Kunde beim Kauf fordert, muss die Anleitung kostenlos in Papierform bereitgestellt werden
Der Hersteller muss auf der Maschine angeben, wie auf die digitalen Betriebsanleitungen zugegriffen werden kann
Diese Anforderung lässt sich in der Regel noch relativ leicht umsetzen. Doch auch sie wirft schon erste Fragen auf.
Für die Kennzeichnung einer Maschine gibt es Regelungen in Abschnitt 1.7.3 des Anhang I MRL bzw. III MVO. Daraus ergibt sich, dass die Angabe auf die Zugriffsmöglichkeit für die Betriebsanleitung „erkennbar, deutlich lesbar und dauerhaft angebracht sein“ muss. Falls dies auf der Maschine nicht möglich ist, dann muss auf ihrer Verpackung oder in einem Begleitdokument angeben, wie auf die digitalen Betriebsanleitungen zugegriffen werden kann.
Ob es sinnvoll ist, einen kompletten Internet-Link auf der Maschine abzudrucken, muss der Hersteller entscheiden. Sinnvoller ist wahrscheinlich ein „maschinenlesbarer Code“ wie z.B. ein QR-Code.
Die Angabe auf die Zugriffsmöglichkeit ist sinnvollerweise in der Nähe des CE-Kennzeichens und des Typenschildes anzubringen. Unter Umständen macht es auch Sinn, sie dort mit anzubringen, wo z.B. mit einem Piktogramm zum Lesen der Betriebsanleitung aufgefordert wird.
Es sind aber auch Fälle denkbar, bei denen es ratsam ist, keinen Hinweis direkt auf der Maschine anzubringen: Wenn z.B. die Maschine im öffentlichen Raum steht und in der Betriebsanleitung sensible Informationen enthalten sind, so ist ein direkter Link, der für Jedermann zugänglich ist, vielleicht nicht gewünscht!
Wie dieser Spagat zwischen Safety und Security aufgelöst werden kann, ist vielleicht ein Thema für den Leitfaden zur neuen Maschinenverordnung. Denn für die Fälle, wo die Information auf der Maschine “nicht möglich” ist, steht grundsätzlich auch der Weg über die Angabe auf der Verpackung oder einem Begleitdokument offen.
Fazit: Diese Anforderung ist grundsätzlich gut machbar.
Das Format muss es dem Nutzer ermöglichen, die Betriebsanleitung auszudrucken, herunterzuladen und auf einem elektronischen Gerät zu speichern
Diese Anforderungen sind auf den ersten Blick nachvollziehbar: Herunterladen und Speichern ist hilfreich, wenn die Internetverbindung nicht dauerhaft stabil ist. Ausdruckbar dagegen engt die Möglichkeiten einer digitalen Betriebsanleitung sehr ein.
Denn wer bei seiner Anleitung über ein einfaches PDF hinausdenkt und z.B. Plattformen für einen modularen Zugriff auf Inhalte verwendet, wer Videos oder Animationen verwendet oder gar auf VR oder Augmented Reality setzt, hat mit der Anforderung „ausdruckbar“ schnell ein Problem. Er muss dann zusätzlich noch eine ausdruckbare Variante seiner Betriebsanleitung erstellen und vorhalten.
Wer dagegen bei seiner digitalen Betriebsanleitung ohnehin nur ein PDF-Format im Blick hat, der wird mit dieser Anforderung kein Problem haben.
Fazit: Machbar, aber mit Einschränkungen für innovativen digitalen Content und Medienformen.
Die Anleitung muss mindestens 10 Jahre online zugänglich sein
Jetzt wird es technologisch durchaus anspruchsvoll! Wissen Sie noch, wie Ihre Webseite vor 10 Jahren ausgesehen hat? Sicher gab es seitdem ein paar Relaunches und viele alte Links, die nicht auf die oberste Ebene gezielt haben, treffen heute wahrscheinlich nicht mehr: “404 Not Found”.
Das darf bei der digitalen Betriebsanleitung nicht passieren. Die Links müssen dauerhaft sein und ein QR-Code auf der Maschine darf nicht plötzlich ins Leere gehen. Das gilt für die voraussichtliche Lebensdauer der Maschine bzw. für mindestens zehn Jahre!
Damit die Umsetzung dieser Anforderung gelingt, braucht es ein gutes Konzept und ausreichend IT-Ressourcen. Denn es wird ja nicht bei einer Anleitung bleiben. Außerdem reicht es nicht, die Anleitungen einfach nur zu archivieren. Sie müssen so gespeichert werden, dass ein aktiver Zugriff auch am Ende des Lebenszyklus der Maschine noch möglich ist.
Die Hersteller sollten also mit folgenden Variablen rechnen: Datenvolumen, Backups, ständiger Zugriff und das für mehr als zehn Jahre. Das gibt es leider nicht umsonst.
Übrigens: Die Betriebsanleitung darf beim online zugänglich machen nicht hinter speziellen Kundenlogins oder anderen Schranken versteckt werden. Der Nutzer muss direkt darauf zugreifen können!
Auch hier stellt sich wieder die Frage nach der Sicherheit. Der Zugang zur Anleitung muss online möglich sein, aber gleichzeitig soll ja nicht jeder Internetnutzer auch über eine entsprechende Suchmaschine oder KI die Inhalte auffinden können. Wie das technisch machbar ist und bleibt, müssen die Spezialisten aus der IT klären!
Damit ist auch die Frage geklärt, ob es ausreicht, eine digitale Betriebsanleitung z.B. als PDF an den Kunden zu senden und ihm die Verantwortung dafür zu übertragen. Genau das geht nämlich nicht, da die Pflicht des online zugänglich machen direkt beim Hersteller liegt. Aber vielleicht liefert auch hier der Leitfaden Ideen für eine praxisnahe Umsetzungsmöglichkeit dieser Anforderung.
Fazit: Machbar, aber durchaus anspruchsvoll in der konkreten und dauerhaften technologischen Umsetzung.
Bei Maschinen, die für nichtprofessionelle Nutzer bestimmt sind, müssen „Sicherheitsinformationen“ in Papierform bereitgestellt werden
Achtung, wer Maschinen im B2C-Bereich vertreibt, der kommt auch in Zukunft nicht ganz ohne Papier aus.
Dann muss der Hersteller nämlich „die Sicherheitsinformationen, die für die sichere Inbetriebnahme der Maschine … und für deren … sichere Verwendung wesentlich sind, in Papierform bereitstellen.“ (Art. 10 Abs. 7 MVO).
Das gilt übrigens auch für so genannte Migrationsprodukte, also für Maschinen, die unter vernünftigerweise vorhersehbaren Umständen von nichtprofessionellen Nutzern verwendet werden können.
Im Leitfaden zur MRL (Auflage 2.3 – April 2024) steht dazu unter § 255:
„Es wird vorausgesetzt, dass diese Informationen mindestens Angaben über die Montage, die Inbetriebnahme, die Verwendung, die Wartung und den Transport der Maschine enthalten sollten und dadurch sichergestellt wird, dass bei der Befolgung dieser Informationen die Sicherheit oder die Gesundheit des Nutzers oder Dritter nicht gefährdet wird.
Diese Informationen sollten mit denen aus der Betriebsanleitung übereinstimmen.
Basierend auf der Risikobeurteilung des Herstellers kann es erforderlich sein, zusätzliche Informationen im Rahmen der Sicherheitsinformationen anzugeben, die als wesentlich angesehen werden“
D.h. eine komplette Umstellung auf ein digitales Format wird nur im B2B-Bereich möglich sein. Auch dort sollte aber im Rahmen der Risikobeurteilung geprüft werden, ob eine rein digitale Betriebsanleitung ausreichend ist oder ob es Informationen gibt, die zwingend in Papierform nötig sind.
Fazit: Obacht bei B2C- und Migrationsprodukten, dort sind Sicherheitsinformationen in Papierform erforderlich.
Wenn es der Kunde beim Kauf fordert, muss die Anleitung kostenlos in Papierform bereitgestellt werden
Und zu guter Letzt muss auch der Kunde noch mitspielen. Denn dieser hat das Recht, zum Zeitpunkt des Kaufs eine Anleitung in Papierform zu verlangen. Und dafür darf der Hersteller auch keine extra Kosten veranschlagen. Denn er muss die Betriebsanleitung auf dieses Verlangen hin kostenlos bereitstellen.
Es wird sich zeigen, welche Klauseln hier im Geschäftsverkehr künftig zum Einsatz kommen und dann im Streitfall auch einer gerichtlichen Prüfung standhalten.
Festzuhalten ist, dass es einen Anspruch des Nutzers darauf gibt, die Anleitung in Papierform vom Hersteller zu erhalten.
Wer seine Maschine nicht direkt an den Kunden veräußert, sondern Händler dazwischen geschaltet hat, muss für seine Lieferketten außerdem beachten:
„Der Hersteller sollte allerdings dafür sorgen, dass die Händler auf Verlangen des Nutzers zum Zeitpunkt des Kaufs in der Lage sind, die Betriebsanleitung kostenlos in Papierform zur Verfügung zu stellen. Der Hersteller sollte auch in Betracht ziehen, die Kontaktdaten anzugeben, unter denen der Nutzer die Zusendung der Betriebsanleitung per Post anfordern kann.“ (MVO, Erwägungsgrund 40)
Fazit: Am Ende ist der Kunde der König. Will er Papier, dann bekommt er auch Papier.
Ab wann gelten die Regelungen für die digitale Betriebsanleitung?
Die neue Maschinenverordnung ist ab 20.1.2027 verpflichtend anzuwenden. Müssen Hersteller also noch gut 1 ½ Jahre warten, bis sie mit der digitalen Anleitung loslegen können?
Die Antwort darauf liefert der Leitfaden zur MRL vom April 2024: Dort hat die EU-Kommission die Regelungen aus der MVO zur digitalen Betriebsanleitung quasi schon vorab in Kraft gesetzt:
„Wenn die Betriebsanleitung in digitaler Form bereitgestellt wird, ermöglichen die Bestimmungen aus Artikel 10 Absatz 7 der neuen Maschinenverordnung (Verordnung (EU) 2023/1230) die Übereinstimmung mit der Maschinenrichtlinie.“
Das heißt, die digitale Betriebsanleitung ist schon vor dem Anwendungsbeginn der MVO eine Option für alle Hersteller. Es gelten aber die oben genannten Anforderungen und Einschränkungen.
Außerdem fehlen derzeit noch konkretere Erläuterung zu den einzelnen Anforderungen z.B. im Rahmen eines Leitfadens zu MVO. Ob eine Neufassung der EN ISO 20607 weiterhelfen wird, ist offen. Dort gab es bisher eher allgemeine Aussagen zu Veröffentlichungsformen in Kapitel 7.
Wünschenswert für Hersteller wären aber in jedem Fall entsprechende Hinweise auf geeignete Formate oder Technologien.
Was gilt für Montageanleitungen?
Bei unvollständigen Maschinen gibt es analog zur Betriebsanleitung die so genannte Montageanleitung. Für diese Montageanleitungen gilt das oben gesagte entsprechend. Auch hier eröffnet der Leitfaden zu MRL schon jetzt die Möglichkeit einer digitalen Form: Grundlage dafür ist Artikel 11 Absatz 7 der neuen MVO.
Was gilt bei anderen CE-Vorschriften?
Bei vielen CE-Vorschriften gibt es keine explizite Regelung zur Form der Anleitung oder Gebrauchsanweisung. Im Blue Guide 2022 ist in Fußnote 114 vermerkt:
„Sofern in spezifischen Rechtsvorschriften nicht anders festgelegt, müssen die Sicherheitsinformationen zwar auf Papier vorgelegt werden, aber es wird nicht verlangt, dass alle Anleitungen ebenfalls auf Papier vorliegen; sie können auch elektronisch oder in einem anderen Datenspeicherungsformat oder sogar auf einer Website bereitgestellt werden. Ist dies der Fall, muss die vollständige Gebrauchsanweisung je nach Verwendungszweck des Produkts während eines angemessenen Zeitraums nach dem Inverkehrbringen des Produkts zugänglich bleiben. Allerdings sollte Verbrauchern, die dies wünschen, immer kostenlos eine Papierversion zur Verfügung gestellt werden. Der Hersteller muss bei der Wahl des Formats für die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitsinformationen den Verwendungszweck und die Endnutzer des Produkts berücksichtigen.“
Um hier für mehr Klarheit und eine rechtliche Basis für die digitale Anleitung zu sorgen, will die EU-Kommission das über das so genannte „Omnibus-IV-Paket“ für viele CE-Vorschriften klarstellen.
Die derzeit geplanten Regelungen sind ähnlich zu denen in der MVO. Bei den Sicherheitsinformationen für Konsumenten kann es ausreichend sein, diese auf dem Produkt zu platzieren anstatt auf einem extra Papier. Das könnte es hier leichter machen, auch im B2C-Bereich ganz auf Papier zu verzichten.
Hart ist dagegen die Frist für die Lieferung einer Papieranleitung auf Wunsch des Kunden. Dort ist nämlich nun von „up to six months after that purchase“ die Rede. Das heißt der Hersteller muss ein halbes Jahr warten, bis er sicher sein kann, dass er tatsächlich keine Anleitung in Papierform liefern muss!
Warum das so geplant ist, ist nicht nachvollziehbar. Außerdem hat das zur Folge, dass bei einem Produkt, das z.B. unter die Maschinenverordnung und die EMV-Richtlinie fällt, zwei unterschiedliche Fristen für das Einfordern einer Anleitung auf Papier gelten können.
Omnibus IV und digitaler Produktpass
Mit dem bereits erwähnten “Omnibus-IV-Paket” soll übrigens auch die neue MVO noch einmal digitaler werden. Die Konformitätserklärung soll dann nur noch digital erstellt werden können. Spätestens dann muss sich übrigens jeder Hersteller mit dem Thema “muss mindestens 10 Jahre online zugänglich” machen auseinandersetzen!
Außerdem wird der digitale Produktpass als führendes Element in die CE-Vorschriften eingeführt. Immer dann, wenn eine CE-Vorschrift einen digitalen Produktpass vorsieht, dann sollen alle Informationen dort abgelegt werden.
Dazu gehört dann auch eine digitale Betriebsanleitung.
Spätestens dann muss sich also jeder Hersteller darüber Gedanken machen, welche Strategie er bei der Digitalisierung der Betriebsanleitung verfolgen will.
CE-CON unterstützt Sie bei der Umsetzung der digitalen Betriebsanleitung
Sie wollen künftig auf eine digitale Form der Betriebsanleitung umsteigen und haben noch Fragen dazu?
Kein Problem: Die Fachleute der CE-CON GmbH unterstützen Sie gerne und helfen Ihnen dabei, den passenden Weg für eine Umstellung von Papier zu digital zu finden.
Schicken Sie uns einfach eine kurze Nachricht und vereinbaren Sie einen Termin mit uns.
Themen: CE-Kennzeichnung / Konformitätserklärung, Maschinenrichtlinie / Maschinenverordnung, Technische Dokumentation, Richtlinien und Normen
„Omnibus IV“: EU will den CE-Prozess digitaler gestalten
Wenn im Zusammenhang mit EU-Vorschriften derzeit der Begriff „Omnibus-Paket“ fällt, dann geht es nicht um den öffentlichen Nahverkehr. Vielmehr will die EU-Kommission mit einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen unnötige Bürokratie abbauen und ein regulatorisches Umfeld schaffen, das Innovation, Wachstum, hochwertige Arbeitsplätze und Investitionen fördert. Die Maßnahmen erstrecken sich von Vorschriften für die Nachhaltigkeitsberichterstattung über eine Vereinfachung der Gemeinsamen Agrarpolitik bis hin zu Ausnahmen im Rahmen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) für kleinere Unternehmen.
Auch die CE-Kennzeichnungsvorschriften werden im Rahmen von „Omnibus IV“ angepasst.
Konkret geht es dabei um folgende Vorschläge für Verordnungen und Richtlinien:
- COM(2025)503 - Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives [...] as regards the digitalisation and alignment of common specifications und
- COM(2025)504 - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations [...] as regards digitalisation and common specifications
Diese Dokumente sind nicht einfach zu lesen, da mit Ihnen eine Vielzahl von CE-Richtlinien und Verordnungen punktuell geändert und ergänzt werden.
Zu diesen Vorschriften gehören folgende CE-Richtlinien:
· 2000/14/EG – Lärmschutz-Richtlinie
· 2011/65/EU – RoHS-Richtlinie
· 2013/53/EU – Sportbootrichtlinie
· 2014/29/EU – Einfache Druckbehälter
· 2014/30/EU – EMV-Richtlinie
· 2014/31/EU – Nichtselbsttätige Waagen
· 2014/32/EU – Messgeräterichtlinie
· 2014/33/EU – Aufzugsrichtlinie
· 2014/34/EU – ATEX-Richtlinie
· 2014/35/EU – Niederspannungsrichtlinie
· 2014/53/EU – Funkanlagenrichtlinie
· 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie
· 2014/90/EU – Schiffsausrüstungsrichtlinie
Sowie folgende CE-Verordnungen:
· (EU) 765/2008 – Akkreditierung und Marktüberwachung
· (EU) 2016/424 – Seilbahnen
· (EU) 2016/425 – Persönliche Schutzausrüstungen
· (EU) 2016/426 – Gasgeräteverordnung
· (EU) 2023/1230 – Maschinenverordnung
· (EU) 2023/1542 – Batterieverordnung
· (EU) 2024/1781 – Ökodesign-Verordnung
Ja, richtig gelesen. Auch die neue Maschinenverordnung soll geändert werden, noch bevor sie am 20.1.2027 anzuwenden ist.
Folgende Änderungen und Neuregelung sind vorgesehen:
Von Papier zu digital
Grundsätzlich will die EU-Kommission das Prinzip „standardmäßig digital“ vorantreiben. In den CE-Vorschriften fehlt dieser Grundsatz bisher aber – im Gegenteil: Es wird sogar in der Regel die Verwendung des Papierformats erwartet!
In den Fragen und Antworten zu Omnibus IV formuliert die EU-Kommission ihre Ziele wie folgt:
„Die Abschaffung verbindlicher Papieranforderungen wird die Behörden dazu ermutigen, ihre Bearbeitung von Einreichungen oder Meldungen durch Unternehmen zu überdenken. Die Straffung dieser Einreichungen und Berichterstattung durch die Förderung von Digital-by-Default wird neue Anreize schaffen, in die Datenerhebung und -verarbeitung mit eGovernment-Lösungen zu investieren. Dies kann den Weg zu einem papierlosen Binnenmarkt ebnen, der auf interoperablen strukturierten Daten und dem Grundsatz der einmaligen Erfassung beruht.“
Für die CE-Vorschriften heißt das konkret:
-
Aufnahme eines „digitalen Kontakts“ in die Herstellerinformationen
-
Digitalisierung der EU-Konformitätserklärung
-
Integration der Konformitätserklärung in den digitalen Produktpass
-
Betriebsanleitungen können in digitaler Form zur Verfügung gestellt werden
-
Digitaler Austausch mit den zuständigen nationalen Behörden und zwischen den Wirtschaftsakteuren
Das Ziel, den CE-Prozess digitaler zu gestalten, ist sicherlich gut gemeint. Ob die Regelungen auch gut gemacht sind und in der Praxis die gewünschte Vereinfachung bringen, muss sich aber erst noch zeigen.
Beispiel digitale Betriebsanleitung: Diese ist jetzt grundsätzlich möglich. Es gilt z.B. für die EMV-Richtlinie 2014/30/EU:
„paragraph 7 is replaced by the following: ‘7. Manufacturers shall ensure that the apparatus is accompanied by instructions and the information referred to in Article 18, in a language which can be easily understood by consumers and other end-users, as determined by the Member State concerned. The instructions and information referred to in Article 18 may be provided in electronic form. Such instructions and information, as well as any labelling, shall be clear, understandable and intelligible.”
D.h. die digitale Betriebsanleitung ist möglich. Gleichzeitig gelten aber auch einige Anforderungen, die eine solche digitale Anleitung erfüllen muss. Sie muss z.B.
· herunterladbar und druckbar sein,
· mindestens 10 Jahre lang online verfügbar sein,
· im B2C-Bereich oder bei so genannten Migrationsprodukten: u.U. teilweise auf Papier und
· auf Wunsch des Kunden bis 6 Monate nach Kauf als Papierversion geliefert werden.
Diese Regelung ist ähnlich zu der, die auch in der neuen Maschinenverordnung vorgesehen ist. Ob das wirklich praxistauglich ist und ob das kleinere Unternehmen auch einfach leisten können und wollen, wird sich zeigen.
Gemeinsame Spezifikationen statt harmonisierten Normen
Ebenfalls schon aus der neuen Maschinenverordnung bekannt ist das Instrument der „Gemeinsamen Spezifikationen“. Damit schafft sich die EU-Kommission eine „rechtlich anerkannte Ausweichoption“ für die Fälle, bei denen harmonisierte Normen zur Umsetzung einer wesentlichen Anforderung bei CE-Vorschriften fehlen. Sie kann mit den Gemeinsamen Spezifikationen Regelungen erlassen, deren Anwendung dann auch die Konformitätsvermutung auslösen – so wie sonst bei der Anwendung harmonisierter Normen.
Digitaler Produktpass (DPP)
Der digitale Produktpass wird zwar (noch) nicht direkt in den bestehenden CE-Vorschriften eingeführt. Aber er wird dort schon mal erwähnt und es gilt z.B. für die Niederspannungsrichtlinie:
„‘5. Where other Union legislation applicable to electrical equipment requires the economic operator to include the information that the product complies with the requirements set out in that legislation in a digital product passport or to upload the EU declaration of conformity or instructions in a digital product passport, the information required in Annex IV to be included in the EU declaration of conformity and the instructions referred to in Article 6(7) shall be provided only in that digital product passport.’;“
D.h. der digitale Produktpass soll zum führenden Instrument für die Sammlung aller CE-relevanten Informationen ausgebaut werden. Sobald er für eine Vorschrift vorgeschrieben ist, sollen dort alle Informationen zusammengeführt werden.
Fazit
Grundsätzlich ist die Idee, die CE-Vorschriften mit mehr digitalen Möglichkeiten auszustatten, durchaus begrüßenswert. Ob die vorgeschlagenen Regeln aber wirklich eine Vereinfachung bringen, darf bezweifelt werden. Gerade bei der digitalen Betriebsanleitung, aber auch beim digitalen Produktpass würde man sich noch mehr Mut wünschen! Derzeit aber erscheint das Omnibus-IV-Paket in diesen Punkten eher mit heißer Nadel gestrickt als wirklich konsequent zu Ende gedacht.
Bleibt zu hoffen, dass im europäischen Gesetzgebungsverfahren noch Verbesserungen eingebracht werden. Dort können das EU-Parlament und die Mitgliedsstaaten noch eingreifen.
Wenn Sie Ihren CE-Prozess schon jetzt digitaler gestalten wollen, dann sprechen Sie uns an. Unsere Fachleute für Maschinensicherheit und Technische Dokumentation unterstützen Sie gern.
Themen: CE-Kennzeichnung / Konformitätserklärung, Software CE-CON Safety, Richtlinien und Normen
Cybersecurity in CE-Vorschriften – Aktueller Stand und Zeitplan
Das Thema Cybersecurity findet sich in immer mehr europäischen
Harmonisierungsrechtsvorschriften (CE-Vorschriften): So zum Beispiel in der
Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU, der neuen Maschinenverordnung (EU) 2023/1230
und natürlich dem Cyber Resiliance Act (EU) 2024/2847.
Im folgenden Beitrag liefern wir Ihnen einen Überblick über den aktuellen Stand der
Umsetzung, den Zeitplan sowie zu den dazugehörigen harmonisierten Normen.
Cybersecurity für Funkanlagen
Für Funkanlagen greift schon ab dem 1.8.2025 eine Cybersecurity-Regelung für mit
dem Internet verbundene Funkanlagen und insbesondere für solche, die
personenbezogene Daten, Verkehrsdaten oder Standortdaten verarbeiten. Eingeführt
wurden diese durch die delegierte Verordnung 2022/30. Und ursprünglich sollte das
auch schon ab dem 1.8.2024 anwendbar sein. Da aber die europäischen
Normgremien etwas länger für die Ausarbeitung von harmonisierten Normen benötigt
haben, wurde der Anwendungsbeginn um ein Jahr nach hinten verschoben – also
auf den 1.8.2025.
Für die Funkanlagen gemäß Richtlinie 2014/53/EU wurden nun die entsprechenden
Cybersecuritiy-Normen im Amtsblatt der EU veröffentlich.
Dort sind nun folgende Normen harmonisiert:
- EN 18031-1:2024 Gemeinsame Sicherheitsanforderungen für Funkanlagen —
Teil 1: Funkanlagen mit Internetanschluss - EN 18031-2:2024 Gemeinsame Sicherheitsanforderungen für Funkgeräte —
Teil 2: Funkgeräte, die Daten verarbeiten, insbesondere internetfähige
Funkgeräte, Kinderbetreuungsfunkgeräte, Spielzeugfunkgeräte und tragbare
Funkgeräte - EN 18031-3:2024 Gemeinsame Sicherheitsanforderungen für Funkgeräte —
Teil 3: Internetfähige Funkgeräte, die virtuelles Geld oder Geldwerte
verarbeiten
Cyber Resilience Act (EU) 2024/2847
Für den Cyber Resilience Act hat die Arbeit an den harmonisierten Normen
gerade begonnen. Hier sind derzeit rund 40 neue Normen geplant. Aktuelle
Informationen dazu haben die europäischen Normungsorganisationen CEN und
CENELEC in einem Webinar am 10. März 2025 geteilt
CE-CON wird die Entwicklung der Normen rund um den Cyber Resilience Act
laufend beobachten und die Anforderungen und Verfahren aus diesen Normen in
die Software CE-CON Safety integrieren.
Anwendungsbeginn für den CRA ist der 11.12.2027.
Aber Achtung: Die Meldepflicht gemäß Art. 14 CRA für aktiv ausgenutzte
Schwachstellen und schwerwiegende Sicherheitsvorfälle beginnt schon am
11.9.2026! Derzeit ist aber noch nicht festgelegt, in welcher Form die Meldung zu
erfolgen hat. Die Einrichtung der einheitlichen Meldeplattform gemäß Artikel 16
CRA ist ebenfalls noch nicht erfolgt. Hersteller von Produkten mit digitalen
Elementen sollten sich aber rechtzeitig informieren, um die Themen
Meldepflichten und auch Software Bill of Materials (SBOM, „Software-Stückliste“)
technisch und organisatorisch vorzubereiten.
Maschinenverordnung (EU) 2023/1230
Auch in der neuen Maschinenverordnung ist die Cybersecurity nun explizit erwähnt.
Schon für die „alte“ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG gilt, dass der Hersteller die
Gefährdungen, die von der Maschine ausgehen können, und die damit verbundenen
Gefährdungssituationen ermitteln muss. Werden bei dieser Ermittlung auch
Gefährdungen aus dem Bereich der Cybersecurity festgestellt, muss der Hersteller
geeignete Maßnahmen ergreifen, um diese Gefährdungen auszuschalten oder durch
Anwendung von Schutzmaßnahmen zu mindern.
Das war bisher aber noch wenig konkret, so dass bei der Novellierung durch die
neue Maschinenverordnung nun zwei neue bzw. erweiterte Abschnitte in die Liste
der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen (Anhang III
MVO) eingefügt wurden:
„1.1.9 Schutz gegen Korrumpierung
Die Maschine bzw. das dazugehörige Produkt muss so konstruiert und gebaut sein,
dass der Anschluss einer anderen Einrichtung an die Maschine oder das
dazugehörige Produkt durch jede Funktion der angeschlossenen Einrichtung selbst
oder über eine mit der Maschine bzw. dem dazugehörigen Produkt kommunizierende
entfernte Fernzugriffseinrichtung nicht zu einer gefährlichen Situation führt.
Ein Hardware-Bauteil, das Signale oder Daten überträgt, die für die Verbindung mit
oder den Zugriff auf Software relevant sind, die für die Konformität einer Maschine
oder eines dazugehörigen Produkts mit den einschlägigen Sicherheits- und
Gesundheitsschutzanforderungen von entscheidender Bedeutung ist, muss so
konstruiert sein, dass es angemessen gegen unbeabsichtigte oder vorsätzliche
Korrumpierung geschützt ist.
Maschinen bzw. dazugehörige Produkte müssen Nachweise für ein rechtmäßiges oder unrechtmäßiges Eingreifen in dieses Hardware-Bauteil sammeln, soweit es für die Verbindung mit oder den Zugriff auf Software relevant ist, die für die Konformität der Maschine bzw. des dazugehörigenProdukts von entscheidender Bedeutung ist.
Software und Daten, die für die Konformität der Maschine oder des dazugehörigen
Produkts mit den einschlägigen Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen
von entscheidender Bedeutung sind, sind als solche kenntlich zu machen und
angemessen gegen unbeabsichtigte oder vorsätzliche Korrumpierung zu schützen.
Die Maschine bzw. das dazugehörige Produkt muss die installierte Software, die für
den sicheren Betrieb erforderlich ist, identifizieren und diese Informationen jederzeit
in leicht zugänglicher Form bereitstellen können.
Maschinen bzw. dazugehörige Produkte müssen Nachweise für ein rechtmäßiges
oder unrechtmäßiges Eingreifen in der Software oder eine Veränderung der auf der
Maschine bzw. dem dazugehörigen Produkt installierten Software oder ihrer
Konfiguration sammeln.“
„1.2.1 Sicherheit und Zuverlässigkeit von Steuerungen
Steuerungen sind so zu konzipieren und zu bauen, dass es nicht zu
Gefährdungssituationen kommt.
Steuerungen müssen so ausgelegt und beschaffen sein, dass
a) sie, wenn den Umständen und Risiken angemessen, den zu erwartenden
Betriebsbeanspruchungen sowie beabsichtigten und unbeabsichtigten
Fremdeinflüssen, einschließlich vernünftigerweise vorhersehbare böswillige
Versuche Dritter, die zu einer Gefährdungssituation führen, standhalten können;
b) ein Defekt der Hardware oder der Software der Steuerung nicht zu
Gefährdungssituationen führt;
c) Fehler in der Logik des Steuerkreises nicht zu Gefährdungssituationen führen;
d) die Grenzen der Sicherheitsfunktionen im Rahmen der vom Hersteller
durchgeführten Risikobeurteilung festgelegt werden, und keine Änderungen der
durch die Maschine oder das dazugehörige Produkt oder den Bediener generierten
Einstellungen oder Regeln, auch während der Lernphase der Maschine oder des
dazugehörigen Produkts, vorgenommen werden dürfen, wenn solche Änderungen zu
Gefährdungssituationen führen könnten;
e) vernünftigerweise vorhersehbare Bedienungsfehler nicht zu
Gefährdungssituationen führen;
f) das Rückverfolgungsprotokoll der Daten, das im Zusammenhang mit einem
Eingreifen generiert wurden, und der Versionen der Sicherheitssoftware, die nach
dem Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme der Maschine oder des
dazugehörigen Produkts hochgeladen wurden, bis zu fünf Jahre nach dem
Hochladen ausschließlich für den Nachweis der Konformität der Maschine oder des
dazugehörigen Produkts mit diesem Anhang auf begründete Anforderung einer
zuständigen nationalen Behörde zugänglich ist.
Steuerungssysteme für Maschinen oder dazugehörige Produkte, deren Verhalten
oder Logik sich vollständig oder teilweise selbst entwickelt und die für einen in
wechselndem Maße autonomen Betrieb ausgelegt sind, müssen so konzipiert und
gebaut sein, dass
a) sie nicht dazu führen, dass Maschinen oder dazugehörige Produkte Handlungen
ausführen, die über ihre festgelegte Aufgabe und ihren festgelegten
Bewegungsbereich hinausgehen;
b) die Aufzeichnung von Daten über den sicherheitsrelevanten
Entscheidungsprozess für softwaregestützte Sicherheitssysteme zur Gewährleistung
der Sicherheitsfunktion, einschließlich der Sicherheitsbauteile, nach dem
Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme der Maschine oder des dazugehörigen
Produkts aktiviert ist und diese Daten für ein Jahr nach ihrer Aufzeichnung
ausschließlich für den Nachweis der Konformität der Maschine oder des
dazugehörigen Produkts mit diesem Anhang auf begründetes Verlangen einer
zuständigen nationalen Behörde gespeichert werden;
c) es jederzeit möglich ist, die Maschine oder das dazugehörige Produkt zu
korrigieren, um seine inhärente Sicherheit zu wahren.
Insbesondere ist Folgendes zu beachten:
a) Die Maschine oder das dazugehörige Produkt darf nicht unbeabsichtigt in Gang
gesetzt werden können;
b) die Parameter der Maschine oder des dazugehörigen Produkts dürfen sich nicht
unkontrolliert ändern können, wenn eine derartige unkontrollierte Änderung zu
Gefährdungssituationen führen könnte;
c) Änderungen der Einstellungen oder Regeln, die von der Maschine oder dem
dazugehörigen Produkt oder vom Bediener vorgenommen wurden, auch während
der Lernphase der Maschine oder des dazugehörigen Produkts, müssen verhindert
werden, wenn solche Änderungen zu Gefährdungssituationen führen könnten;
d) das Stillsetzen der Maschine oder des dazugehörigen Produkts darf nicht
verhindert werden, wenn der Befehl zum Stillsetzen bereits erteilt wurde;
e) ein bewegliches Teil der Maschine oder des dazugehörigen Produkts oder ein von
der Maschine oder dem dazugehörigen Produkt gehaltenes Werkstück darf nicht
herabfallen oder herausgeschleudert werden können;
f) automatisches oder manuelles Stillsetzen von beweglichen Teilen jeglicher Art darf
nicht verhindert werden;
g) nichttrennende Schutzeinrichtungen müssen uneingeschränkt funktionsfähig
bleiben oder aber einen Befehl zum Stillsetzen auslösen;
h) die sicherheitsrelevanten Teile der Steuerung müssen kohärent auf eine
Gesamtheit von Maschinen oder von dazugehörigen Produkten oder auf
unvollständige Maschinen oder eine Kombination aus diesen einwirken.
Bei kabelloser Steuerung darf ein Ausfall der Kommunikation oder Verbindung oder
eine fehlerhafte Verbindung nicht zu einer Gefährdungssituation führen.“
Diese beiden Abschnitte sind nun deutlich konkreter als die bisherigen Informationen
im Rahmen der Maschinenrichtlinie. Allerdings sind auch diese wesentlichen
Anforderungen noch eher allgemein gehalten. Wie genau und mit welchen Verfahren
sie dann praktisch umgesetzt werden, muss auch hier in harmonisierten Normen zur
neuen Maschinenverordnung geregelt werden.
Eine erste solche Norm ist derzeit auch in Arbeit und es gibt einen ersten
Normentwurf:
- prEN 50742 Safety of machinery - Protection against corruption
Diese Norm soll für die Umsetzung von Anhang III, 1.1.9. und Anhang III, 1.2.1. a)
und f) die notwendigen Informationen liefern. Sie ist für eine
Amtsblattveröffentlichung unter der neuen Maschinenverordnung vorgesehen und
wird hoffentlich rechtzeitig vor dem Anwendungsbeginn der neuen
Maschinenverordnung am 20.1.2027 zur Verfügung stehen.
Für Fragen rund um die Maschinensicherheit und die Cybersecurity stehen Ihnen die
Experten der CE-CON GmbH zur Verfügung. Nehmen Sie gerne Kontakt dazu mit
uns auf!
Themen: CE-Kennzeichnung / Konformitätserklärung, Software CE-CON Safety, Richtlinien und Normen
Im Juni 2025 wurde die EN 17975:2025 Maintenance - Risk control processes of
energies and fluids risks in maintenance activities – Guidance veröffentlicht.
Die Norm wurde bei CEN erstellt. Gestartet wurden die Arbeiten an der EN 17975
Anfang 2022. Der Entwurf wurde im April 2023 veröffentlicht und das "date of
Announcement (DOA)" der EN 17975 ist laut CEN für Ende September vorgesehen.
Die deutsche Fassung wird voraussichtlich im September/Oktober 2025 verfügbar
sein.
Zielsetzung der Norm EN 17975
Zahlreiche Statistiken zur Arbeitssicherheit zeigen: Viele Unfälle passieren nicht im
Normalbetrieb von Anlagen, sondern sind auf einen fehlerhaften Umgang mit den
Energiequellen bei Instandhaltungsarbeiten zurückzuführen. Diese Unfälle haben
oftmals schwerwiegende Folgen für die betroffenen Personen, Betriebseinrichtungen
und Betriebsabläufe.
Als erfolgreiches Konzept gegen solche Unfälle infolge von fehlender Isolierung von
Energien und Fluiden hat sich Lockout/Tagout (LOTO) schon länger in verschiedenen
Industriezweigen durchgesetzt.
Da LOTO ursprünglich aus den USA kommt (siehe OSHA1910.147) und es bisher
keine europäische Norm dazu gab, hatten sich teils unterschiedliche Begrifflichkeiten
und Konzepte entwickelt.
Dem soll jetzt die neue Norm EN 17975 „Instandhaltung – Verfahren zur Kontrolle der
Risiken von Energien und Fluide bei Instandhaltungsaufgaben – Leitfaden“
entgegenwirken und so für mehr Klarheit und Einheitlichkeit sorgen.
Stellung der Norm EN 17975
Normen sind grundsätzlich Empfehlungen und beeinflussen daher nicht direkt die
nationalen Gesetze und Verordnungen. Sie dürfen diesen aber natürlich nicht
entgegenstehen.
Die Anwendung des LOTO-Verfahrens ist unter anderem in der DGUV Information
209-015 erläutert. Denn dort wird die so genannte „4-Rang-Methode“ beschrieben,
deren Rang 1 dem LOTO-Prozess gleicht. Auch §10 Absatz 3 Nr. 6 BetrSichV
erwähnt eine Notwendigkeit Instandhaltungspersonal vor laufenden Maschinen und
Energien zu schützen, gibt aber keine spezifischen Vorgaben für die Durchführung.
Den Vorschlag für eine spezifische Durchführung macht nun die Norm, die wie oben
gesagt eine Empfehlung dafür ist.
Fazit: LOTO wird generell als bewährter Prozess zur Gewährleistung der Sicherheit
bei Instandhaltungsarbeiten betrachtet. Mit der EN 17975 liegt nun erstmals ein
europäischer Standard vor, der die Organisation und den Prozess von LOTO
umfassend beschreibt.
Angebote von CE-CON
Unsere Erfahrung zeigt: Die meisten LOTO-Projekte scheitern schon ganz am
Anfang, weil Prozesse und Abläufe nicht bekannt und eingeübt sind. CE-CON bietet
Ihnen die fachliche und organisatorische Unterstützung beim Start und der
Durchführung Ihres LOTO-Projekts, z.B. durch ein passendes Vorlagenmanagement
oder die mobile Erfassung der Anlagen vor Ort.
Full Service Supplier
Dabei unterstützen wir Sie als Full Service Supplier für die Einführung und
Umsetzung des Lockout Tagout Verfahrens. Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen Ihre
unternehmensweite Policy, bieten spezifische Schulungen und E-Learnings an und
übernehmen die praktische Umsetzung an Ihren Maschinen und Anlagen bis hin zur
Ausstattung mit allen notwendigen Hilfsmitteln und Schlössern.
https://www.ce-con.de/beratung/loto/
Softwarelösung CE-CON LOTO
Unsere Software CE-CON LOTO ist eine cloudbasierte Lösung für Arbeitsschützer
und Instandhalter, mit der Sie LOTO-Prozeduren standardisiert planen, umsetzen
und dauerhaft dokumentieren – einfach, sicher und nachvollziehbar.
- LOTO-Prozeduren erstellen und verwalten: CE-CON LOTO bietet Ihnen
Vorlagen, Textbausteine und mediengestützte Arbeitsanweisungen, mit denen
Sie Ihre LOTO-Prozeduren effizient und standardisiert erstellen und verwalten
können. - Projektorientierte Organisation: In CE-CON LOTO können Sie ganze
Betriebsstätten, unterschiedliche Hallen und einzelne Anlagen strukturiert
abbilden. Übersichtspläne, Abbildungen und Fotos können einfach
hochgeladen werden. - Mobile Nutzung vor Ort: Mit CE-CON LOTO können Sie mobil und direkt an
der Maschine vor Ort arbeiten. Damit sind die notwendigen Daten für Ihre
LOTO-Prozeduren sofort an der richtigen Stelle. - Zusammenarbeit im Team und mit Externen: Mit CE-CON LOTO arbeiten Sie
cloudbasiert, weltweit und ohne Installationsaufwand. So können Sie
standortübergreifend zusammenarbeiten und auch externe Dienstleister
mühelos in Ihre Prozesse einbinden. - Rechtssicher dokumentieren: Mit CE-CON LOTO erfüllen Sie die gesetzlichen
Anforderungen nach OSHA und Betriebssicherheitsverordnung (§ 10 Absatz 3
BetrSichV) und dokumentieren Ihre LOTO-Prozeduren rechtskonform.
https://www.ce-con.de/ce-con-loto/
Webinar
Unser kostenloses Webinar richtet sich an Arbeitsschützer und Instandhalter und
alle, die für LOTO-Prozeduren verantwortlich sind. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit CE-
CON LOTO Ihren LOTO-Prozess optimieren können.
https://www.ce-con.de/kostenlose-webinare-ce-con-safety-fuer-lockout-tagout-loto/
Themen: LoTo - Lockout Tagout, Software CE-CON Safety, Richtlinien und Normen
Zusammenspiel von Maschinenrichtlinie und Druckgeräterichtlinie
Produkte, die in den Anwendungsbereich mehrerer EU-
Harmonisierungsrechtsvorschriften (CE-Vorschriften) fallen, sind auch für erfahrene
CE-Verantwortliche immer wieder eine Herausforderung. Im folgenden Beitrag
zeigen wir Ihnen, was bei typischen Fällen beim Zusammentreffen von
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (MRL) bzw. der zukünftigen Maschinenverordnung
(EU) 2023/1230 (MVO) und Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (DGRL) zu beachten
ist und welche Softwaretools Hersteller bei der Umsetzung der Vorschriften
unterstützen.
Zusammenspiel von CE-Vorschriften
Im System der CE-Vorschriften ist es vorgesehen, dass sich die Vorschriften
überschneiden und einander ergänzen. Denn sie decken ja eine breite Palette von
unterschiedlichen Produkten, Gefahren und Auswirkungen ab. Deshalb müssen für
ein einziges Produkt möglicherweise mehrere CE-Vorschriften berücksichtigt werden.
Und das Produkt darf nur dann bereitgestellt und in Betrieb genommen werden,
wenn es alle anzuwendenden Bestimmungen erfüllt und die Konformitätsbewertung
gemäß den anzuwendenden CE-Vorschriften durchgeführt wurde.
Die Gefahren, die durch die Anforderungen der verschiedenen CE-Vorschriften
ausgeschaltet werden sollen, betreffen verschiedene Aspekte, die einander in vielen
Fällen ergänzen (z. B. geht es in der Richtlinie über die elektromagnetische
Verträglichkeit um andere Gefahren als in der Niederspannungsrichtlinie), so dass
die gleichzeitige Anwendung mehrerer CE-Vorschriften erforderlich ist. Hersteller
müssen dann alle anzuwendenden CE-Vorschriften berücksichtigen - wenn keine
Ausnahmeregeln vorliegen. Siehe dazu auch Blue Guide Kapitel 2.7. Gleichzeitige
Anwendung von Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union.
Wie ist das nun beim Zusammenspiel von Maschinenrichtlinie und
Druckgeräterichtlinie? Wenn ein Produkt also sowohl bewegliche Teile hat, die nicht
ausschließlich von der menschlichen Kraft angetrieben werden, und gleichzeitig mit
einem maximal zulässigen Druck von über 0,5 bar arbeitet.
Dann sind nach dem grundsätzlichen Anwendungsbereich sowohl die
Maschinenrichtlinie als auch die Druckgeräterichtlinie anwendbar. Beide CE-
Vorschriften regeln auch verschiedene Aspekte und Gefahren, so dass die
gleichzeitige Anwendung beider Vorschriften erstmal nahe liegt. Allerdings stellt sich
noch die Frage nach den Ausnahmen: Und davon gibt es tatsächlich auch welche zu
beachten.
Typische Fallbeispiele
Das lässt sich an drei Beispielen gut darstellen:
Im ersten Fall baut der Hersteller eine typische Maschine und fügt dieser eine
Komponente – zum Beispiel einen Verdichter – hinzu, die bereits eine CE-
Kennzeichnung nach der Druckgeräterichtlinie hat und auch für den Einbau in eine
Maschine vorgesehen ist.
Im zweiten Fall baut der Hersteller eine Maschine mit einer Druckkomponente (z.B.
einer einfachen Pumpe), die nicht höher als Kategorie I der Druckgeräterichtlinie
eingestuft ist.
Und auch im letzten Fall baut der Hersteller eine Druckkomponente (z.B. einen
komplexeren Verdichter) in seine Maschine ein. Dieser Verdichter fällt unter die
Kategorie III der Druckgeräterichtlinie.
Im ersten Fall ist es so, dass der Hersteller der Maschine sich grundsätzlich auf die
Konformität seines zugekauften Verdichters verlassen darf. Er muss also kein
erneutes Konformitätsbewertungsverfahren für dieses Druckgerät durchführen. Er
muss aber die Konformitätserklärung für den zugekauften Verdichter in seine
Technische Dokumentation aufnehmen. Außerdem muss er in der Risikobeurteilung
für seine Maschine die Schnittstellen zum Druckgerät betrachten. Und er muss die
Benutzerinformationen zum zugekauften Verdichter (Warnhinweise,
Wartungsanweisungen) in seine Betriebsanleitung integrieren. Unterstützung beim
CE-Prozess, der Dokumentation und der Risikobeurteilung bieten unsere Experten
von der CE-CON.
Der zweite Fall ist deutlich komplexer. Denn hier ist der Hersteller der Maschine auch
vollumfänglich für das Druckgerät – also die einfache Pumpe – verantwortlich, das er
ja selbst konstruiert und baut.
Es gilt Artikel 3 der Maschinenrichtlinie:
„Werden die in Anhang I genannten, von einer Maschine ausgehenden
Gefährdungen ganz oder teilweise von anderen Gemeinschaftsrichtlinien genauer
erfasst, so gilt diese Richtlinie für diese Maschine und diese Gefährdungen nicht bzw.
ab dem Beginn der Anwendung dieser anderen Richtlinien nicht mehr.“
Die Druckgeräterichtlinie ist eine solche andere Richtlinie. Das ist auch im Leitfaden
zur MRL entsprechend vermerkt:
„In Übereinstimmung mit Artikel 3, ist die DGRL anwendbar auf die
Druckgefährdungen von Druckgeräten, die in ihren Anwendungsbereich fallen und
die in Maschinen eingebaut oder mit ihnen verbunden sind.“ (Leitfaden MRL § 91)
Aber im Zusammenspiel von MRL und DGRL gibt es eine wichtige Ausnahme:
Artikel 1 Abs. 2 f) DGRL: „Diese Richtlinie gilt nicht für: …
f) Geräte, die nach Artikel 13 dieser Richtlinie höchstens unter die Kategorie I fallen
würden und die von einer der folgenden Richtlinien erfasst werden:
i) Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates“
Das steht auch so im Leitfaden der MRL: „Druckgeräte, die nicht höher als in
Kategorie 1 eingestuft sind und in Maschinen eingebaut werden, die in den
Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie fallen, sind aus dem
Anwendungsbereich der DGRL ausgenommen. Die Maschinenrichtlinie gilt dann in
vollem Umfang für derartige Geräte.“
Und der Leitfaden zur Druckgeräterichtlinie ergänzt:
„In diesen Fällen sind die wesentlichen Sicherheitsanforderungen der DGRL ein
geeigneter Weg, um das geforderte Sicherheitsniveau in Bezug auf die
Druckgefährdungen zu erreichen.“
Wichtig: Das Konformitätsbewertungsverfahren richtet sich in diesen Fällen allein
nach der Maschinenrichtlinie. D.h. das in der Regel die interne Fertigungskontrolle
nach Modul A ausreichend ist und keine benannte Stelle eingeschaltet werden muss.
Auf der Konformitätserklärung wird auch nur die MRL angegeben und nicht die
DGRL.
Anders ist es im letzten Fall. Bei Druckgeräten (wie hier beispielsweise bei einem
selbstgebauten Verdichter) der Kategorie II oder höher greift die Ausnahme aus
Artikel 1 Abs. 2 f) nicht mehr. D.h. Druckgeräte mit einer höheren Kategorie als
Kategorie I fallen unter den Anwendungsbereich der DGRL, selbst wenn es sich bei
ihnen um eine Maschine i.S.d. Maschinenrichtlinie handelt oder wenn sie dafür
vorgesehen sind, Bestandteil einer Maschine zu werden.
Es gelten beide Richtlinien gleichzeitig. Der Hersteller muss auch die
Konformitätsbewertungsverfahren beider Vorschriften beachten. Das heißt im Falle
eines Druckgerätes der Kategorie III, dass eines der folgenden Module angewandt
werden muss:
- Modul B (Entwurfsmuster) + Modul D
- Modul B (Entwurfsmuster) + Modul F
- Modul B (Baumuster) + Modul E
- Modul B (Baumuster) + Modul C2
- Modul H
Alle diese Module sehen die Beteiligung einer benannten Stelle (z.B. TÜV NORD
Systems GmbH & Co. KG) vor. Auf der Konformitätserklärung werden in diesem Fall
auch beide CE-Vorschriften genannt.
Nützliche Software-Tools für die
Maschinenrichtlinie und die DGRL.
Für Hersteller, die Produkte planen, die unter die MRL oder die DGRL fallen, gibt es
nützliche Softwaretools, die bei der Risikobeurteilung oder einer optimalen
Auslegung von Druckgeräten für mehr Sicherheit und Verfügbarkeit helfen.
DIMy – Dimensionierungs-Software für Druckgeräte
Während es im Anlagen-, Apparate- und Rohrleitungsbau auf die wirtschaftliche
Herstellung der drucktragenden Systeme und ihrer Komponenten ankommt, sind für
die Betreiber dieser Anlagen neben den Investitionskosten auch die
Betriebssicherheit und Verfügbarkeit entscheidend. Darauf hat die Dimensionierung
und Ausführung der sicherheitsrelevanten Komponenten großen Einfluss. Die
optimale Auslegung nach den vielfältigen Sicherheits- und Berechnungsstandards
erfordert viel Zeit und Erfahrung.
DIMy ist ein leistungsstarkes grafikunterstütztes
Software-System des TÜV NORD, das Anlagenplaner, Konstrukteure und
Sachverständige bei der Berechnung, Optimierung und Prüfung von Komponenten
unterstützt und entlastet.
(https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/industrie/betreiber/dimy-dimensionierungs-software-fuer-druckgeraete-new/)
Software CE-CON Safety
Die cloudbasierte Software-Lösung zur effizienten und rechtskonformen
Risikobeurteilung. Seit 2008 macht CE-CON Safety die Risikobeurteilung und CE-
Kennzeichnung von Maschinen und vielen weiteren Produkten einfach! Die Software-
Lösung sorgt für sichere Produkte – und dafür, dass Hersteller das komplette CE-
Konformitätsbewertungsverfahren lückenlos durchführen und dokumentieren! Egal
ob sie Betriebsmittel bauen, Sondermaschinen konstruieren oder Ihre Serienprodukte
weltweit vertreiben.
https://www.ce-con.de/en/ce-con-safety-software/
Themen: Risikobeurteilung, CE-Kennzeichnung / Konformitätserklärung, Richtlinien und Normen









.png)